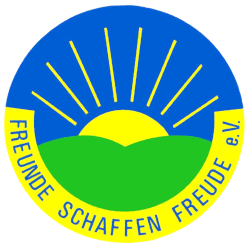Zarte Seifenblasen gegen den Krebs
FsF Mitarbeiter als Klinik-Clowns an der Universitätskinderklinik in Ulm
Universitätskinderklinik Ulm, Station VI. Die exakte Bezeichnung für diesen Ort lautet „Hämatologische, onkologische und immunologische Station“. In der Umgangssprache hat sich ein kürzerer Begriff herausgebildet: Kinderkrebsabteilung. Hier werden Kinder mit Leukämie, Tumoren und Abwehrschwächen behandelt. Ein paar Männer und Frauen tun an diesem Ort Dienst als Klinik-Clowns. Die Sonntagszeitung hat zwei Clowns aus dem Heidenheimer Landkreis begleitet.

Iwa hat die merkwürdigen Ärzte als erste entdeckt. Das Mädchen im Kindergartenalter flitzt auf ihrem Tretroller durch den Gang hinter den beiden her. Als sie die falschen Ärzte erreicht, sagt sie erst einmal nichts. Sie schaut. Mit vor Staunen großen Augen, die noch größer wirken in dem zarten Gesicht, weil alle Haare auf ihrem Kopf ausgefallen sind. Iwa ist kahlköpfig, wie die meisten anderen Patienten auf dieser Station – wo Kinder auffallen, die ihre Haare nicht verloren haben.
Dr. Theo Tölpel und Professor Dr. Knallkopf schenken dem staunenden Mädchen einen Luftballon. Iwa ist schon lange in der Klinik und die falschen Doktoren sind nicht die ersten Clowns, die ihr einen Besuch abstatten. Aber es wirkt, als erscheine dem Kind die Begegnung mit einem Clown im Krankenhaus immer aufs Neue wie ein Wunder.
Später sitzen die drei zusammen im Krankenzimmer der Patientin, spielen mit Stofftieren und Dr. Tölpel wird die Taucherbrille aufsetzen und Iwa seinen berühmten Kopfstand vorrühren.
Dr. Theo Tölpel und Dr. Knallkopf stammen aus Demmingen und heißen eigentlich Siggi Feil und Inge Grein-Feil, die Gründer der Aktion „Freunde schaffen Freude“. Sie gehören zu einem Team, das jeden Mittwoch versucht, die Kinder wenigstens für kurze Zeit von ihrer Krankheit abzulenken und sie zum Lachen zu bringen. Die Klinik-Clowns sind dem Verein Hieroniemuß-Doctor-Clowns angeschlossen.
„Medizinische Studien haben ergeben, dass positive Gefühlsregungen das Immunsystem anregen“, wissen die Clowns. Die Selbstheilungskräfte werden gestärkt. Dieser „Heilmethode“ wurde bereits ein Kinofilm gewidmet:
„Patch Adams“, benannt nach dem gleichnamigen amerikanischen „Erfinder“ der Idee, bei dem die Demminger eine Fortbildung absolviert haben. Bei ihrer ehrenamtichen Clownerie können die beiden auch auf ihre spiel- und theaterpädagogische Ausbildung zurückgreifen.
Im Nebenzimmer weint ein Kind. Die Familie ist um das Bett versammelt, die Türe ist geschlossen. Beim letzten Mal konnte Marius von den Clowns nicht genug bekommen. Jetzt will der Vierjährige niemanden sehen. „Er hatte heute seine Chemo“, erklärt die Krankenpflegerin. Noch einen anderen Jungen auf der Station sollen die Clowns nicht besuchen. Auch bei ihm ist die Familie versammelt. Er kämpft im Endstadium mit dem Krebs. Gerade mal 13 Jahre alt.
Im Stockwerk darüber dürfen die Clowns ebenfalls nicht die Zimmer der Patienten betreten. Dort liegen Kinder in keimfreier Umgebung. Jedes für sich, von der Außenwelt durch eine Glasscheibe getrennt. Die Clowns auf der einen Seite, die Kinder auf der anderen. Oft müssen die kleinen Patienten Monate in der isolierten Kammer verbringen. Nur Ärzte und die Eltern dürfen die Zimmer betreten – durch eine Schleuse, in sterilen Schutzanzügen wie Astronauten.

Aber auch die Kinder in der Station VI werden vor Viren so gut es geht geschützt. In ihrem Blut sind durch die schmerzhafte Chemo-Behandlung zu wenig Leukozyten. Eine Erkältung könnte ihnen die letzte Kraft rauben, weil ihre Abwehrkräfte zu wenig entgegenzusetzen hätten. Deshalb liegen auch sie in Einzelzimmern. Wenn sie sich gut fühlen und die Zahl ihrer Leukozyten stimmt, dürfen sie ihr Zimmer verlassen. Sie sollen möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, auch nach der Entlassung dürfen sie lange Zeit keine öffentliche Schule oder einen Kindergarten betreten. Für sie hat die Uniklinik eigene Lehrerinnen angestellt. Laurin hat bereits mehrfach gefragt, wann denn die Clowns endlich kommen. Bei Laurin liegt die Zahl der Leukozyten unter dem kritischen Bereich von 1000. Um den Achtjährigen in seinem Zimmer zu besuchen, müssen die Clowns deshalb sterile blaue Kittel über ihre geflickte Arztkleidung ziehen, Hände waschen und desinfizieren. Vom Bett aus blickt Laurin ihnen erwartungsvoll entgegen. Es sind keine großen Kunststücke, die die Clowns zeigen, die Späße sind spontan, mit einem festen Programm geht es nicht. Einmal sind Tölpel und Knallkopflaut und tollpatschig, dann wieder leise und sanft. Je nachdem wie die Patienten reagieren.
Besuch auf allen Vieren. Hanna wird gesund
Bei einer ängstlichen Einjährigen robbt Dr. Tölpel auf allen Vieren ins Zimmer, um ihr ein paar Seifenblasen entgegen zu pusten. Sie staunt. Dann lacht sie. „Das erste Mal heute“, sagt ihre Mutter. Den Rest des Nachmittags will die Einjährige die Clowns nicht mehr aus den Augen lassen. Sie lacht noch oft. Hanna wird gesund.
Der Clown-Job ist kräftezehrend. Wenn die falschen Ärzte in ein Zimmer platzen, prallen sie zumeist erst auf eine Wand aus Betroffenheit, Beklemmung und Schweigen. Mit ihrer gespielten Naivität, ihren Scherzen und ihrer scheinbar absoluten Unbefangenheit machen sie sich daran, die Mauer zu zerschlagen. Meist sind Erwachsene und Kinder gleichermaßen erleichtert darüber.
So wie bei Benjamin. „Geht mal da rein“, hatte die eigens als Spielkameradin für die Kinder angestellte Erzieherin gebeten, „der Benjamin kann es gebrauchen.“
Eigentlich benimmt sich der 14-Jährige, als könne er mit Clowns nichts anfangen. Während sie ihre Spaße machen, bastelt er in seinem Bett an einem Modellflugzeug. Er sieht kaum auf, nur, wenn er glaubt, dass keiner ihn beachtet, riskiert er einen Blick. Aber dass die Clowns wieder gehen, dass will er auch nicht.
Man spürt, dass der Junge wütend ist und verletzten will. Irgendjemanden. Aber man spürt auch, dass es nur die eigenen Wunden sind, die ihn dazu treiben, die Angst und die Hilflosigkeit. „Benjamin“, murmelt er, laut genug, dass alle im Raum es hören können, „so ein bescheuerter Name“. Es klingt, als trage die Namenswahl Schuld am Krebs. Als sei alles ein verhängnisvolles Missverständnis: Benjamin ist zwar krank. Aber eigentlich sollte er ja gar nicht dieser Benjamin sein.
Seine Mutter ist verletzt. Aber sie versucht, sich nichts anmerken zu lassen. „Er mag seinen Namen nicht“, entschuldigt sie sich bei den Clowns. „Ach, so was“, wundert sich Knallkopf und fragt Benjamin: „Wie willst du denn sonst heißen?“ Der Teenager zuckt abweisend mit den Schultern: „anders“. Da wundert sich auch Dr. Tölpel und sagt: „‚Anders‘ ist doch auch kein schöner Name“, und da muss der Junge dann doch lachen und die Mauer ist durchbrochen.
Damit werde er hier abhauen, erklärt Benjamin den Clowns und deutet auf sein halbfertiges Jagdflugzeug: „Und dann werfe ich Bomben auf das Krankenhaus.“ Tölpel ist begeistert. „Wunderbar, aber mach das nicht mittwochs, wenn wir da sind“, ruft er und fängt auch gleich an, das Bombenwerfen zu üben. Mit der Wärmflasche. Darüber lachen Benjamin und seine Mutter gemeinsam.
Ein Journalist habe einmal von dunklen, trostlosen Krankenhausfluren geschrieben, in denen die Clowns der einzige Lichtblick seien, erzählt Reinhard Böhm, der als Prof. Dr. Hieroniemuß Pinkel die andern Clowns eingewiesen hat. Aber damit tue man dem Pflegepersonal unrecht.
Tatsächlich sind die Gänge hell und freundlich. An den Wänden hängen bunte Kinderbilder und überall liegt Spielzeug. Man sieht, dass das Krankenhauspersonal sich um die Kinder bemüht – so gut es geht bei Stress und Überbelegung. Sogar an die Geschwister der kranken Kinder wurde gedacht, ein Förderverein kümmert sich zweimal in der Woche kostenlos um die Betreuung. Die Pflegerinnen albern mit den Clowns und sogar die Ärzte lassen es zu, Zielscheibe der Späße ihrer falschen Kollegen zu sein.
Lisa ist nicht mehr in ihrem Zimmer. „Da ist jetzt Loren drin“, erklärt die Krankenpflegerin. Inge Grein-Feil notiert sich die Änderung in ihrem Notizbüchlein. Jedes Kind wird mit Namen angesprochen. Die Clowns lieben die Kinder, das steht außer Frage. Aber die 55-Jährige fragt trotzdem nicht, was denn mit Loren sei. Die Clowns fragen bei keinem der Kinder nach dem Schicksal, nach Heilungschancen.
Zum Heulen auf die Toilette
Mitleid darf nicht sein. Solche Gefühle dürfe man sich erst erlauben, wenn man das Kostüm ausgezogen und die Schminke abgewischt habe. Geweint werde genug. Bloß keine zusätzlichen Tränen. „Wenn alle so tun, als sei man schon gestorben, kann man ja nicht gesund werden“, glaubt Inge Grein-Feil.
Als sie beim Anblick eines Babys einmal die Tränen nicht unterdrücken konnte, weil es sie an ihr eigenes Kind erinnert hat, das sie mit 18 Jahren bekam und das nur ein halbes Jahr alt wurde, ist Inge zum Heulen aufs Klo gerannt
Auf dem Flur kommt den Clowns ein kleines Mädchen mit ihrem Vater entgegen. „He, du bist doch Caroline“, ruft Knallkopf. Caroline nickt, aber sie hat es eilig. Sie will auch keine Clownnase geschenkt bekommen. „Wir gehen heim“, verrät der Vater und strahlt. „He!“, ruft Knallkopf noch mal und lacht. Dieses Mal klingt das Lachen anders als sonst, leichter.
Dann wird der Clown doch ernst, entgegen der Regeln. „Hör zu,“ sagt Inge streng zu dem Kind, dem in den nächsten Wochen wieder Haare wachsen werden: „ich will dich nie, nie wieder sehen!“
Kontaktmöglichkeit

Wer Näheres über die Arbeit der Clowns wissen oder vielleicht sogar selbst ein Klinikclown werden möchte, kann sich beim Verein „Hieroniemuß-Doctor-Clowns“, Vorsitzenden und Clown-Organisator Reinhard Böhm unter Telefon 0 83 87 / 95 16 19 melden. Auskünfte erteilen auch Siggi und Inge Grein-Feil unter Telefon 0 73 27 / 54 05.
Über weitere Möglichkeiten, wie den krebskranken Kindern und ihren Eltern geholfen werden kann, informiert der Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder unter Telefon 07 31 / 96 60 90.